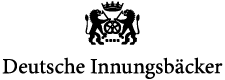
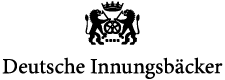
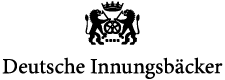



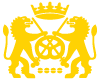
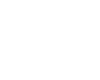

Wer herzhaft in ein knuspriges Roggenbrot beißt, ahnt nicht, dass er gerade das Ergebnis von über 12.000 Jahren mühsamer Züchtungsarbeit genießt. Denn ungefähr zu dieser Zeit begannen die Menschen in Mesopotamien damit, Gerste und die ersten Urformen des Weizens anzubauen. Durch die gezielte Auslese von Pflanzen mit erwünschten Eigenschaften gelang es nach und nach, die Gesundheit der Pflanzen zu verbessern und vor allem die Erntemengen zu steigern. Auch im Ackerbau gab es große Fortschritte, die Verfahren zur Düngung, Bewässerung und Beseitigung des Unkrauts wurden immer ausgefeilter. Ein großer Schritt war das gezielte Kreuzen verschiedener Wildgrasarten, aus denen schließlich die heutigen Getreidearten hervorgingen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs kamen chemische Dünge- und Pflanzenschutzmittel auf, die noch einmal für ungeahnte Ertragssprünge sorgten. Auf guten Böden kommen Landwirte heute leicht auf zehn Tonnen Weizen oder Roggen pro Hektar – eine Menge, die ein Bauer vor 12.000 Jahren selbst in guten Jahren wohl nie zu Gesicht bekommen hat.
Text: Jürgen Beckhoffer
Type 405, Type 550, Type 1050 – dieser Hinweis fehlt auf fast keiner Mehltüte. Aber was bedeutet er? Kurz gesagt nennt die Typenzahl die Menge an Mineralstoffen in Milligramm, die in 100 Gramm Mehl enthalten ist. Je größer die Zahl, desto mehr Schalenanteile des Korns wurden vermahlen und desto gesünder das Mehl. Aber: Mit steigender Typenzahl wird das Mehl immer dunkler. Außerdem lässt sich Mehl mit hohen Typenzahlen schlechter verbacken, weil es langsamer Flüssigkeit aufnimmt. Vollkornmehl hat keine Typenzahl. Grund: Die Menge an Mineralstoffen schwankt bei Vollkornmehl zu stark.